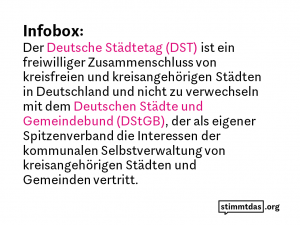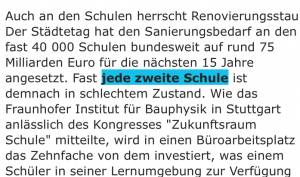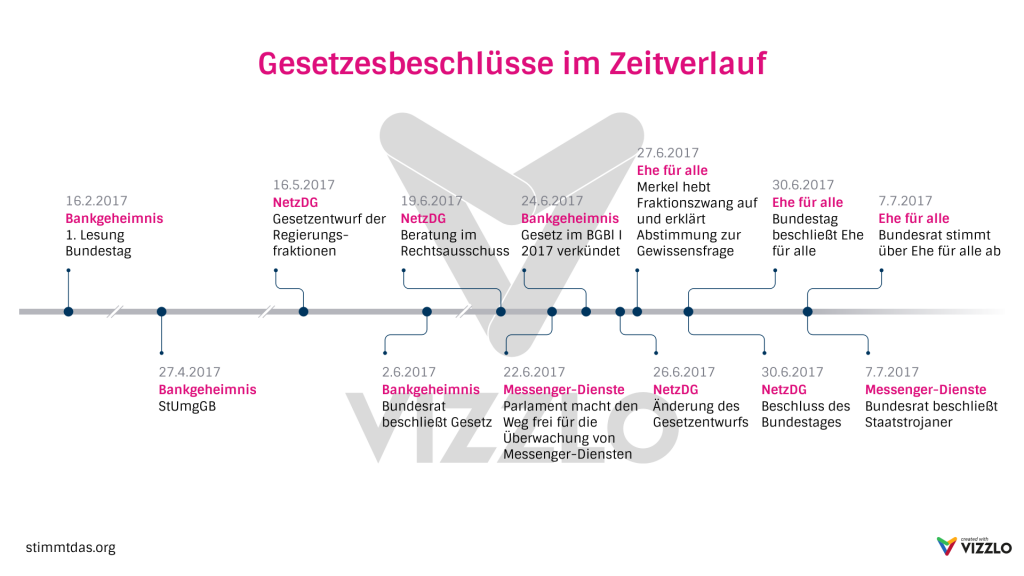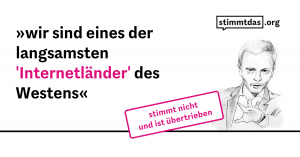Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Georg Pazderski behauptet in einer Pressemitteilung vom 18.05.2018, dass die deutsche Bundesregierung die tatsächlichen Kosten für die Flüchtlingskrise verschweigt. Laut Pazderski liegen die Kosten für das Jahr 2017 bei 50 oder gar 55 Milliarden Euro und nicht bei rund 21 Milliarden, wie es einen Tag zuvor in verschiedenen Medienberichten hieß. Diese Zahl wurde mittlerweile durch einen Kabinettsbeschluss der Bundesregierung bestätigt. Der AfD-Politiker beruft sich in der Pressemitteilung auf das Institut der Deutschen Wirtschaft und das Institut für Wirtschaftsforschung. stimmtdas.org ist diesen Quellen nachgegangen und hat herausgefunden, dass die Zahlen so nicht stimmen. Die 50 Milliarden sind eine Aufsummierung aus Schätzungen für die Jahre 2016 und 2017. Die 55 Milliarden sind das obere Ende einer möglichen Spanne, die in einer Studie angegeben wurde. Die Bundesregierung veröffentlicht regelmäßig Berichte zu ihren Ausgaben im Bereich Asyl- und Flüchtlingspolitik. Der Vorwurf der Verschleierung und Intransparenz kann hier nicht gelten. Der Aussage von Pazderski verpassen wir deshalb ein klares „stimmt nicht“.

Auf Anfrage, in welchen Studien der genannten Institute die Zahlen genau zu finden sind, antwortete die Pressestelle der AfD, dass man sich auf einen Gastbeitrag Wolfgang Boks in der Neuen Züricher Zeitung (NZZ) bezogen habe. In dem Beitrag, der in der Kategorie „Meinung“ im September 2017 erschien, schreibt der Autor unter anderem: „Das Kieler Institut für Wirtschaftsforschung kalkuliert mit bis zu 55 Milliarden Euro pro Jahr.“
55 Milliarden als Worst-Case-Szenario des Kieler Instituts für Wirtschaftsforschung
Ende 2015 veröffentlichte das Institut tatsächlich das Ergebnis einer Simulation zur Schätzung der Flüchtlingskosten bis zum Jahr 2022. Nach dieser Prognose könnten sich die Kosten für Integration und Versorgung auf 55 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. Allerdings beschreibt diese Schätzung das teuerste Szenario. Im günstigsten Fall, auch den haben die Forscher prognostiziert, könnten die jährlichen Kosten bei rund 25 Milliarden Euro liegen, was die AfD in ihrer Pressemitteilung unerwähnt lässt.
Das Institut der Deutschen Wirtschaft distanziert sich
In dem Artikel der NZZ heißt es weiter: „Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) kommt auf den Betrag von 50 Milliarden, den auch der Sachverständigenrat für 2017 errechnet hat.“ Das IW bestätigte, dass die Zahl 50 Milliarden tatsächlich aus einem Kurzbericht stammt, den es Anfang 2016 veröffentlichte. Die Summe bezieht sich allerdings auf einen Zeitraum von zwei Jahren, wie Pressesprecher Leonard Goebel gegenüber stimmtdas.org. erklärte. Die Autoren des Berichts schätzten damals, dass sich die staatlichen Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung von Geflüchteten auf rund 17 Milliarden Euro im Jahr 2016 und auf ca. 23 Milliarden Euro im Jahr 2017 summieren würden. „Die Aussage stimmt also nicht“, sagt Goebel in Bezug auf die Pressemitteilung der AfD. In einer weiteren Studie von Anfang 2017 korrigierte das Institut die Summe aufgrund der gesunkenen Flüchtlingszahlen außerdem um 3 Milliarden Euro nach unten und schätzte, dass sich die staatlichen Kosten für die Flüchtlingshilfe im Laufe des Jahres auf knapp 20 Milliarden Euro belaufen würden.
Der Sachverständigenrat hat die Zahl nie herausgegeben
Im Gastbeitrag der NZZ, auf den sich die AfD beruft, heißt es, auch der Sachverständigenrat habe den 50-Milliarden-Betrag errechnet. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, umgangssprachlich auch als die fünf Wirtschaftsweisen bezeichnet, gab im Jahresbericht 2015/2016 allerdings keine Schätzung für das Jahr 2017 ab. „Wir haben in unseren Veröffentlichungen keine Kostenschätzung von 50 Mrd. Euro abgegeben“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Nach den aktuellsten Berechnungen (S. 289, Ziffer 583) des Sachverständigenrates belaufen sich die Ausgaben für Flüchtlingsmigration in den Jahren 2017 und 2018 auf maximal 0,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, was pro Jahr in etwa 10 bis 13 Milliarden Euro entspricht. „Dieser Betrag liegt unter den Angaben der Bundesregierung, da diese eine andere Abgrenzung vornimmt. Beispielsweise werden von der Bundesregierung noch 6,8 Mrd Euro für die ‚Bekämpfung der Fluchtursachen‘ einbezogen,“ so die Sprecherin.
Verschleiert die Regierung die Kosten für Grundschulen, Kindergartenplätze, und Polizisten?
In der Pressemitteilung fordert Pazderski die Bundesregierung abschließend dazu auf, „das Lügen und Verschleiern“ zu beenden und zum Beispiel zusätzliche Kosten für 180.000 Kindergartenplätze für Migranten, 2.400 neue Grundschulen und 15.000 Polizisten transparent zu machen. Die Zahlen stammen ebenfalls aus dem Artikel der NZZ. Gehen wir sie der Reihe nach durch:
180.000 Kindergartenplätze für Kinder von Migrantinnen: Diese Zahl taucht online nirgendwo anders auf und es bleibt unklar, woher Pazderski bzw. der Gastautor der NZZ sie genau beziehen. Aus dem Bericht über die Maßnahmen des Bundes zur Unterstützung von Ländern und Kommunen im Bereich der Flüchtlings- und Integrationskosten, den die Bundesregierung dem Bundestag jährlich vorgelegt, geht hervor, dass der Bund von 2017 bis 2020 insgesamt 1.126 Millionen Euro für den Ausbau der Kindertagesbetreuung zahlt (S. 3–4) und sich so an den Kosten beteiligt, die den Ländern und Kommunen durch die zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen entstehen. Der Vorwurf, dass zusätzliche Kosten für Kitas verschwiegen würden, ist unberechtigt.
2.400 Grundschulen: Diese Zahl stammt aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung von Juli 2017. Darin heißt es (S. 6), aufgrund steigender Geburtenzahlen und verstärkter Einwanderung würden bis zum Jahr 2025 bundesweit fast 2.400 neue Grundschulen benötigt. Die Zahl 2.400 ist also eine Handlungsempfehlung der Bertelsmann-Stiftung. Der empfohlene Bedarf ist nur zum Teil auf erhöhte Schülerzahlen durch Migration zurückzuführen. Was die Ausgaben im Bereich Schulbildung für Geflüchtete angeht, so nennt die Bundesregierung in ihrem letzten Bericht zu den Flüchtlings- und Integrationskosten (S. 8) für das Jahr 2016 eine Summe von 87 Millionen Euro, die unter anderem für Maßnahmen zur Sprachförderung an Schulen für Flüchtlingskinder ausgegeben wurden. Auch hier macht die Bundesregierung ihre zusätzlichen Ausgaben transparent.
Die 15.000 PolizistInnen stehen im aktuellen Koalitionsvertrag. Darin verspricht die Regierung im Bereich der inneren Sicherheit neue Stellen in Bund und Ländern zu schaffen. Aufstocken will man unter anderem bei Sicherheitsbehörden wie dem Bundeskriminalamt (BKA) und dem Verfassungsschutz mit dem Ziel, Cyber-Kriminalität und Terror zu bekämpfen. Die AfD-Pressemitteilung suggeriert, dass 15.000 neue Polizisten eingestellt werden sollen, um sich allein mit Geflüchteten zu beschäftigen. Auch das stimmt nicht.
Was hat die Flüchtlingskrise laut Bundesregierung gekostet?
In einem aktuellen Bericht, der Ende Mai vom Kabinett beschlossen wurde, heißt es, dass der Bund im Jahr 2017 insgesamt rund 20,8 Milliarden Euro an Flüchtlingshilfe geleistet hat. Davon gingen rund 6,6 Milliarden Euro an die Länder und Kommunen, um sie bei der Integration der Geflüchteten zu entlasten. Etwa 6,8 Milliarden Euro investierte Deutschland in die Bekämpfung von Fluchtursachen. Im aktuellen Finanzplan der Bundesregierung (S. 39, Tabelle 6) wird geschätzt, dass Kosten, die Bund und Ländern durch Asyl und Migration entstehen, in diesem Jahr wieder etwas ansteigen werden, auf etwa 21,4 Milliarden Euro.
Fazit: Die AfD stellt die offiziellen Zahlen der Bundesregierung zur Flüchtlingskrise infrage und unterstellt ihr die Verschleierung der wahren Kosten. Allerdings hat die Partei keine validen Zahlen, mit denen sie ihre Vorwürfe belegen kann, wie dieser Faktencheck zeigt. Wenn man genauer hinschaut bzw. nicht zwei Jahre zu einem aufsummiert, zeigt sich, dass die Angaben der Regierung sich mit den Schätzungen des Instituts für Wirtschaft (IW) weitgehend decken. Dieses hatte die Kosten für das Jahr 2017 auf 23 Milliarden geschätzt. Nach den Berechnungen der Wirtschaftsweisen lagen die Ausgaben im Jahr 2017 bei maximal 13 Milliarden Euro. Dabei rechneten die ExpertInnen nur die Kosten in Deutschland ein und berücksichtigten nicht die Investitionen im Ausland zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Das Kieler Instituts für Wirtschaftsforschung ließ in einer Studie einen breiten Spielraum von 25 bis zu 55 Milliarden Euro. Die AfD vereinfachte hier massiv und nannte nur die Obergrenze der Schätzung, also die höchste Zahl. Diese und weitere Beispiele zeigen, dass genaue Kosten für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen schwer zu berechnen sind, da oft eine allgemein gültige Bemessungsgrundlage fehlt. Der Bundesregierung pauschal Verschleierung zu unterstellen, ist jedoch schlichtweg nicht korrekt, da Zahlen und Bilanzen öffentlich zugänglich sind.
Außerdem wurden in der Pressemitteilung die Zahlen 180.000 Kindergartenplätze für MigrantInnen, 2.400 neue Grundschulen und 15.000 PolizistInnen genannt und in ein falsches Verhältnis zur Frage nach den Kosten für Asylsuchende und deren Integration gestellt. Die Aussage Pazderskis bzw. die gesamte Pressemitteilung bewertet stimmtdas.org daher mit „stimmt nicht“.